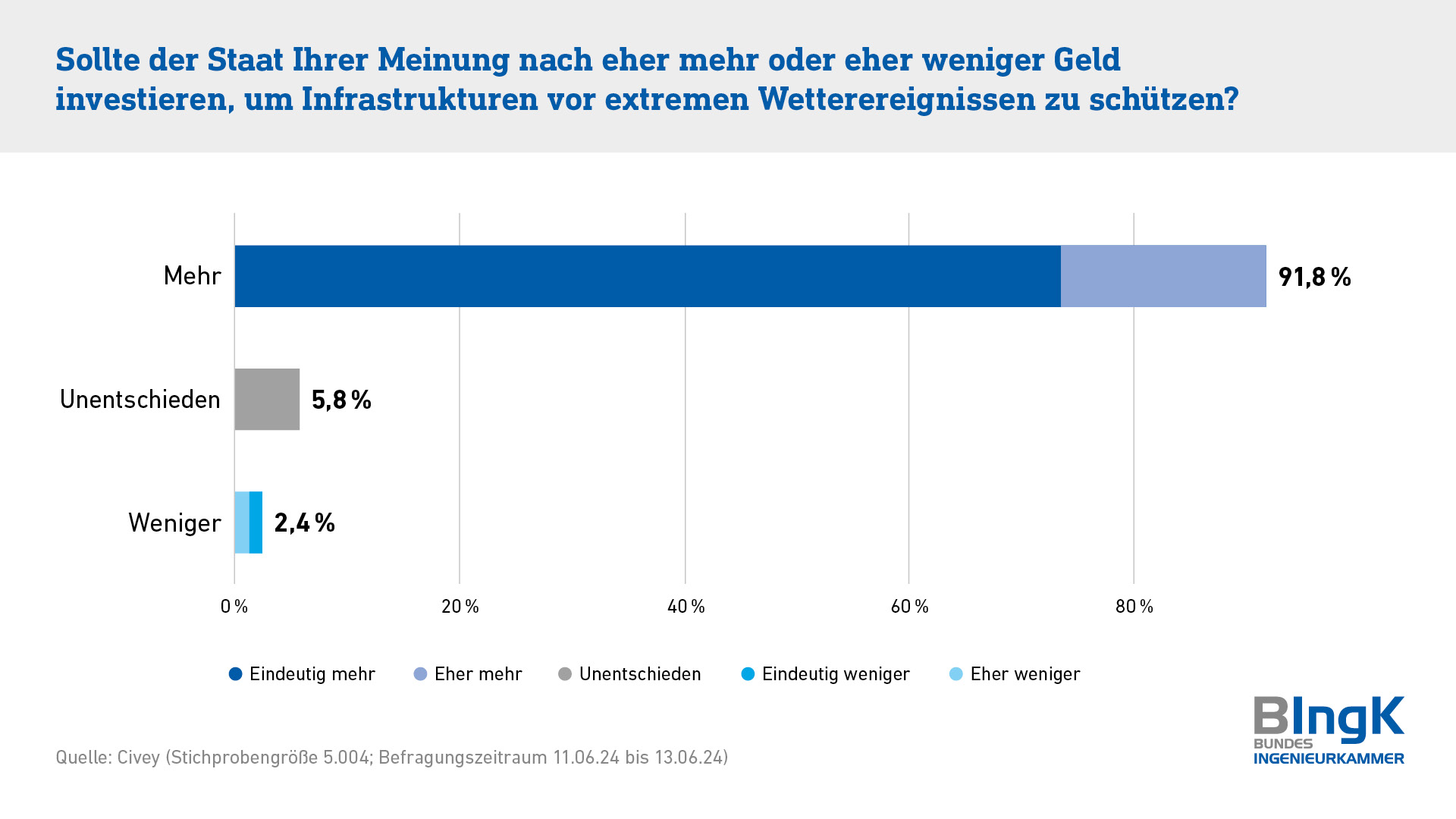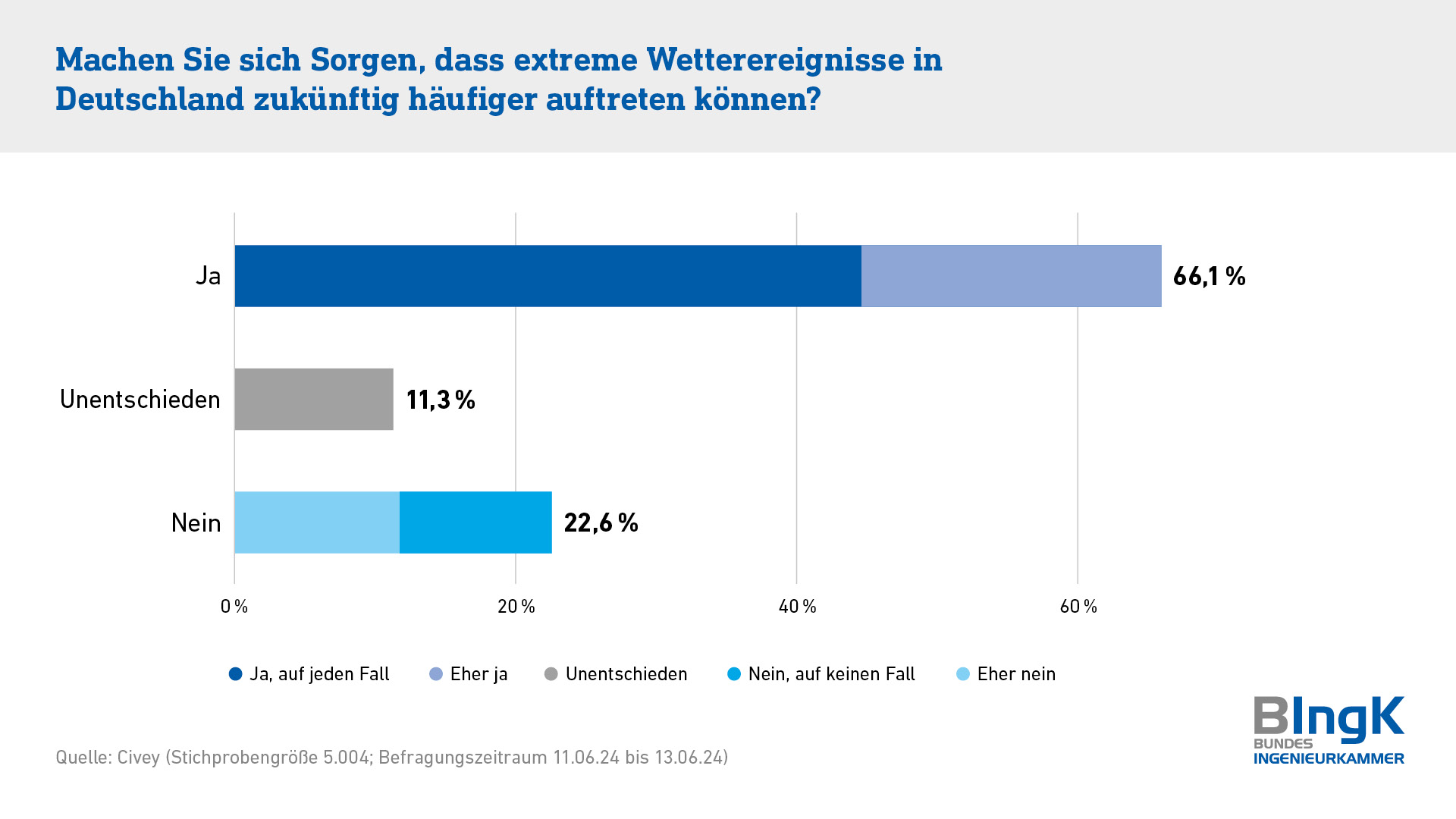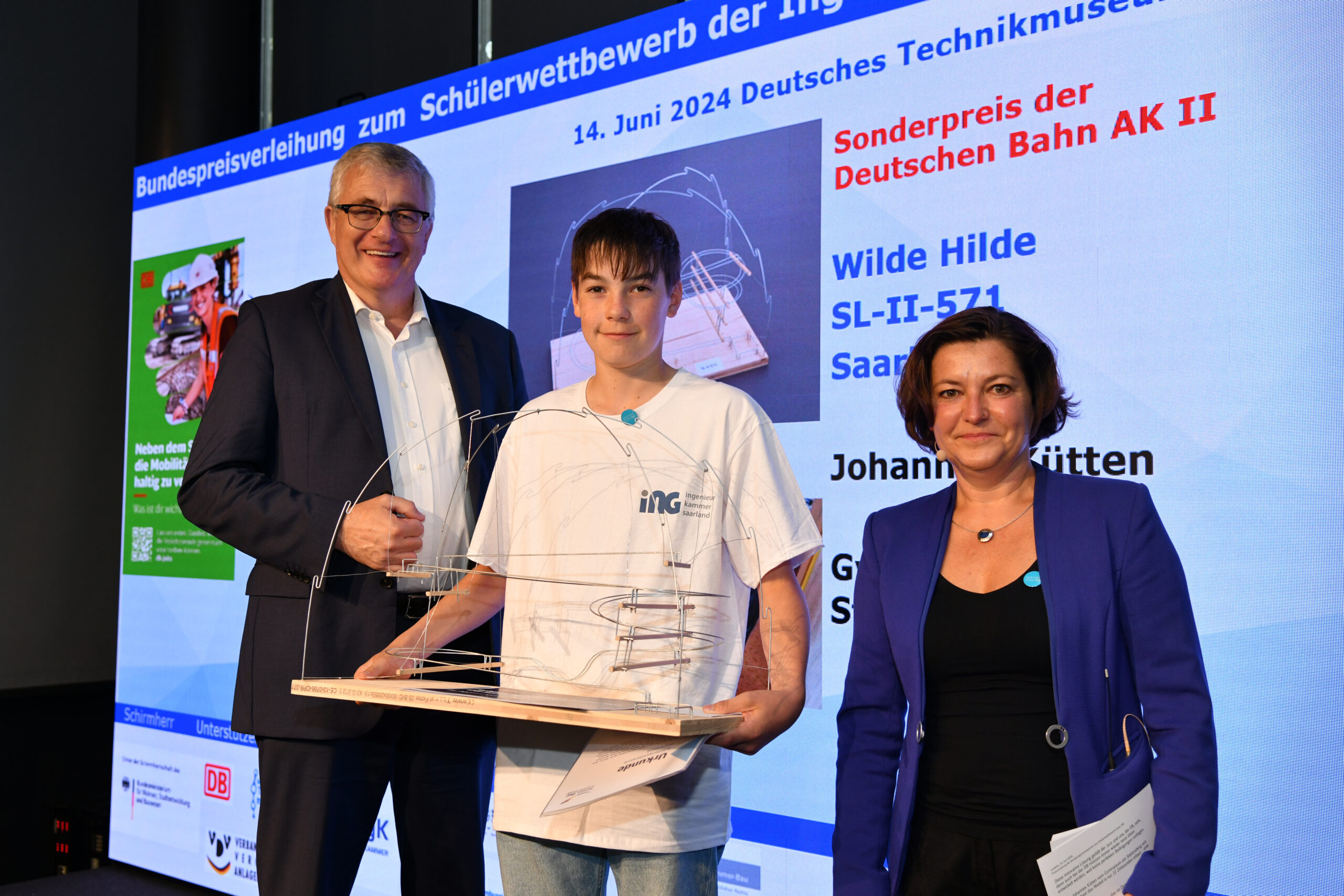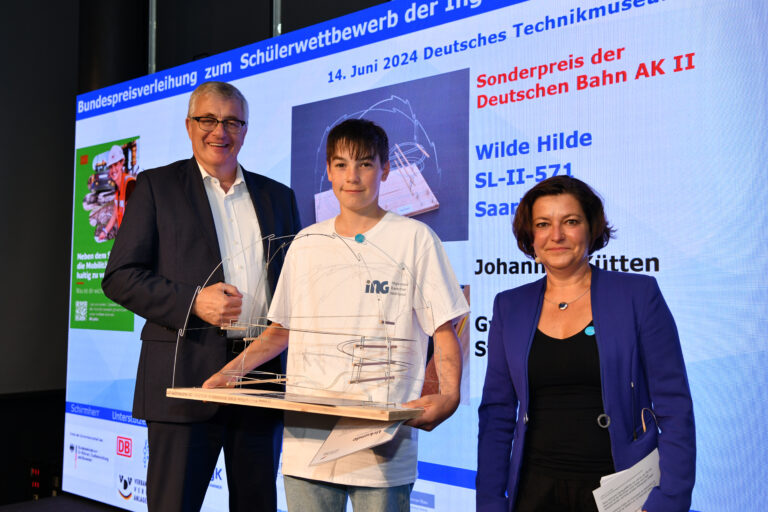In einem am 15. Juli 2024 veröffentlichten Forderungspapier appelliert die Bundesingenieurkammer in einem breiten Bündnis an die Bundesregierung, Maßnahmen zur Förderung der Lebenszyklusbetrachtung im Bauwesen umzusetzen. Dies ist von zentraler Bedeutung, um Klima- und Ressourcenschutz voranzubringen, die Grundlagen für einen wirtschaftlich starken, zukunftssicheren Bausektor zu schaffen und nicht den Anschluss an die Vorreiter in Europa zu verlieren.
Die kürzlich novellierte europäische Gebäuderichtlinie (EPBD) stellt erstmals Anforderungen, die Treibhausgasemissionen über den gesamten Lebenszyklus von Gebäuden zu erfassen und zukünftig deutlich zu reduzieren. Daher braucht es neue Politikinstrumente, um Klimaneutralität und Nachhaltigkeit zu erreichen und dabei die Wettbewerbsfähigkeit des Bausektors zu sichern. Durch eine umfassende Ökobilanz können die Umweltauswirkungen eines Gebäudes über den gesamten Lebenszyklus analysiert und bewertet werden. Auf dieser Grundlage ist es möglich, gezielt Maßnahmen zu identifizieren, die Umweltbelastungen minimieren.
Eine der Hauptforderungen des gemeinsamen Appells ist die Einführung einer Deklarationspflicht für die Ökobilanzierung im Gebäudeenergiegesetz (GEG) für Neubauten und größere Sanierungen ab 2026. Die Pflicht soll schrittweise auf alle neuen Wohn- und Nichtwohngebäude ausgeweitet werden. Für einkommensschwache Eigentümer von Ein- und Zweifamilienhäusern sowie kleinen Mehrfamilienhäusern sollen die zusätzlichen Kosten einer Ökobilanz durch eine sozial gestaffelte Förderung abgedeckt werden.
Darüber hinaus sollen öffentliche Gebäude eine beispielgebende Rolle spielen und als sichtbare Symbole für nachhaltiges Bauen dienen. Ab März 2025 sollen alle neu errichteten öffentlichen Gebäude, insbesondere Schulen, Kindertagesstätten, Pflegeheime und Verwaltungsgebäude, konkrete Anforderungen für die Lebenszyklus-Treibhausgasemissionen erfüllen. Dies soll durch den Einsatz ressourceneffizienter und umweltfreundlicher Materialien sowie durch den Umbau oder die Sanierung bestehender Gebäude anstelle von Neubauten erreicht werden.
Nachhaltiges Bauen und Lebenszyklusbetrachtung stärken
Der Bau- und Gebäudesektor spielt eine vielschichtige Rolle im Zusammenhang mit dem Klimawandel. Er ist mit rund 40 Prozent der deutschen Treibhausgasemissionen nicht nur maßgeblich für den Klimawandel verantwortlich, sondern auch stark von dessen Auswirkungen betroffen. Gleichzeitig birgt er als zentraler Bereich großes Potenzial, denn durch die Implementierung effizienter und suffizienter Bauweisen, die Nutzung erneuerbarer Energiequellen, den Einsatz regenerativer Baumaterialien sowie zirkulärer Bauweisen und die Anwendung innovativer Technologien kann er wesentlich zur Reduzierung der Treibhausgasemissionen beitragen. Diese Emissionen stammen nicht nur aus dem Betrieb der Gebäude, sondern aus dem gesamten Lebenszyklus – von der Herstellung der Baumaterialien bis hin zum Rückbau und der Entsorgung. Die Bedeutung der grauen Emissionen, die während der Herstellung von Baumaterialien und Bauprodukten entstehen, nimmt kontinuierlich zu. Bei einem typischen Wohnungsneubau in Deutschland resultieren etwa die Hälfte der Treibhausgas-Emissionen und des Energieaufwands, die über einen Lebenszyklus von 50 Jahren insgesamt verursacht werden, aus der Herstellung der Baumaterialien und der Errichtung des Gebäudes1. Durch eine umfassende Ökobilanz können die Umweltauswirkungen eines Gebäudes über den gesamten Lebenszyklus analysiert und bewertet werden. Auf dieser Grundlage können gezielte Maßnahmen identifiziert werden, um die Umweltbelastung zu minimieren.
Um die Förderung der Nachhaltigkeit im Bauwesen und die ganzheitliche Betrachtung des Lebenszyklus von Gebäuden zu intensivieren, wurden in den letzten Jahren erste wichtige Schritte unternommen. So wurde im Juli 2021 das Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude (QNG) eingeführt. Dieses staatliche Gütesiegel wird im Rahmen des Förderprogramms für klimafreundlichen Neubau (KfN) der Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) für Neubauten verliehen. Dennoch schreitet die Entwicklung nicht so schnell voran, wie es wünschenswert und notwendig wäre. Andere EU-Staaten sind bereits deutlich weiter – Dänemark, die Niederlande und Frankreich haben bereits verpflichtende Grenzwerte im Ordnungsrecht verankert, eine Reihe weiterer nordischer Staaten haben mindestens eine Offenlegungspflicht beschlossen und einige andere haben die Einführung von Grenzwerten angekündigt2. Deutschland kann sich bis zum Ende dieser Legislatur keinen Stillstand erlauben. Dies wäre nicht nur mit Blick auf den Klima- und Ressourcenschutz problematisch, sondern hätte auch industriepolitisch negative Auswirkungen. Die heimische Industrie sowie kleine und mittelständische Unternehmen müssen sich rechtzeitig auf die Transformation des Bauwesens einstellen und von der Entwicklung neuer Märkte profitieren können.
Daher fordern wir die Bundesregierung auf, noch in dieser Legislaturperiode aktiv zu werden und durch die Umsetzung der folgenden Maßnahmen eine ganzheitliche Lebenszyklusbetrachtung und die Nachhaltigkeit des Bauwesens zu fördern:
1. Deklarationspflicht für große Wohn- und Nichtwohngebäude ab 2026 einführen
Mit der neuen Europäischen Gebäuderichtlinie (EPBD) sind erstmals konkrete Anforderungen hinsichtlich der Berücksichtigung und Begrenzung des Lebenszyklus-Treibhauspotenzials von Gebäuden auf europäischer Ebene in Kraft getreten, die innerhalb von zwei Jahren in nationales Recht überführt werden müssen.
Daher sollte für den Neubau von großen Wohn- und Nichtwohngebäuden im Gebäudeenergiegesetz (GEG) eine Deklarationspflicht für das Ergebnis der Ökobilanzierung gemäß den QNG-Bilanzregeln (basierend auf DIN EN 15643 und EN 15978) eingeführt werden. Angesichts der Relevanz und Bedeutung der bevorstehenden Sanierungswelle ist es essenziell, sich auch im Gebäudebestand intensiv mit der Ökobilanzierung auseinanderzusetzen. Daher sollte diese Deklarationspflicht auch bei Sanierungen größerer Gebäude gelten, wobei vereinfachend nur die baulichen Maßnahmen bilanziert werden. Für kleinere Gebäude sollten praktikable Lösungen 3 entwickelt werden, die einfach umsetzbar sind, den Klimaschutz unterstützen und bezahlbar sind.
Diese Pflicht sollte analog zu anderen Vorgaben des GEG festgelegt werden, also für Nichtwohngebäude ab einer beheizten Fläche von 1.000 m² und für Wohngebäude mit mehr als 10 Wohneinheiten. Diese Deklarationspflicht soll ab dem Jahr 2026 gelten, um genügend Vorbereitungszeit zu gewährleisten und sicherzustellen, dass ausreichend Life-Cycle-Assessment (LCA)-Experten und Expertinnen verfügbar sind. Durch den Ausbau der Kapazitäten sollen die Voraussetzungen geschaffen werden, dass ab spätestens 2028 die Deklarationspflicht für alle neuen Wohn- und Nichtwohngebäude gilt. Die zusätzlichen Kosten einer Ökobilanzierung sollten insbesondere für einkommensschwache Eigentümer und Eigentümerinnen von Ein- und Zweifamilienhäusern, sowie kleinen Mehrfamilienhäusern vollumfänglich durch eine sozial gestaffelte Förderung abgedeckt werden. Weitere Anreize zur vorzeitigen Deklaration bei kleineren Wohn- und Nichtwohngebäuden könnten etwa durch Vorteile wie beschleunigte Bearbeitung, geringere Auflagen und eine reduzierte Steuerlast erfolgen.
2. Die Vorbildfunktion öffentlicher Gebäude stärken
Öffentliche Gebäude spielen eine entscheidende Rolle als Vorbilder für Nachhaltigkeit im Bauwesen. Als sichtbare Symbole der Gemeinschaft tragen sie dazu bei, Bewusstsein zu schaffen und Standards zu setzen. Durch die Implementierung von nachhaltigen Baupraktiken und den ressourceneffizienten Einsatz umweltfreundlicher Materialien können öffentliche Gebäude nicht nur ihre eigenen Umweltauswirkungen reduzieren, sondern auch andere Bauprojekte inspirieren und dazu ermutigen, ähnliche Maßnahmen zu ergreifen. Diese Vorbildfunktion ermöglicht es, den gesamten Bausektor auf dem Weg zu mehr Nachhaltigkeit anzuführen und somit einen positiven Einfluss auf die Umwelt und die Gesellschaft insgesamt auszuüben.
Daher sollten alle neu errichteten öffentlichen Gebäude, insbesondere neue Schulen, Kitas, Pflegeheime, Verwaltungsbauten und kulturelle Einrichtungen ab März 2025 einen spezifischen Anforderungswert (QNG Premium Niveau) für die Lebenszyklus- Treibhausgasemissionen unterschreiten müssen. Perspektivisch sollte sich dieser Grenzwert nach dem Top-Down-Ansatz am vorhandenen CO₂-Restbudget orientieren.
Jede Tonne CO2-Äquivalent, die heute freigesetzt wird, hat eine deutlich größere langfristige Klimaauswirkung als Treibhausgas-Emissionen, die erst in 50 Jahren entstehen. Daher sollte zunächst bei öffentlichen Gebäuden nicht nur das Total Global Warming Potential (GWP total), sondern auch das GWP_fossil der Kostengruppe 300 (gemäß DIN 276:2018-12) sowie der Herstellungsphase (A1-A3) separat bilanziert und limitiert werden. Auf der Grundlage vorhandener Bilanzierungsmethoden und gesammelter Daten sollten entsprechende Emissionsgrenzwerte entwickelt werden, die sowohl den aktuellen als auch zukünftigen Klimaschutzzielen dienen. Die Berücksichtigung insbesondere der Module A1-A3 ist auch entscheidend, um die kumulativen EPBD-Ziele bis 2030 zu erreichen.
Ziel sollte immer der Umbau oder Sanierung vor Abriss und (Ersatz-)Neubau sein. Dies ist ressourcenschonender und verursacht bedeutend weniger THG in der Bauphase. Aktuell werden die grauen Energien und Emissionen, die im Bestandsgebäude stecken und diejenigen, die durch einen Abbruch verursacht werden (Abbruch, Abtransport, Entsorgung) nicht mitbilanziert. Dadurch stellt sich ein Ersatzneubau bilanziell oft besser dar, als er eigentlich ist. Nur wenn die grauen Emissionen und die graue Energie des Rückbaugebäudes einem geplanten Ersatzneubau in Rechnung gestellt werden, kann der tatsächliche ökologische Fußabdruck bei Abriss und Neubau ganzheitlich bewertet und reduziert werden.
3. Stakeholder Prozess zur Entwicklung eines Reduktions-Fahrplans starten
Die geforderten Maßnahmen sind nur ein kleiner, aber dringend notwendiger Schritt auf dem langen Weg hin zur Nachhaltigkeit und Klimaneutralität des Gebäudesektors. So müssen etwa laut EPBD alle Mitgliedstaaten bis Anfang 2027 einen Fahrplan zur Einführung von Lebenszyklus-Treibhausgasemissions-Grenzwerten mit einem Absenkpfad zur Erreichung der Klimaneutralität bis 2045 vorlegen. Es ist von entscheidender Bedeutung, dass Deutschland in diesem zentralen Handlungsfeld nicht den Anschluss verliert und sichergestellt wird, dass alle beteiligten Akteure und Akteurinnen und Wirtschaftszweige auf die Herausforderungen im Zuge der Bauwende vorbereitet sind.
Daher fordern wir die Einrichtung eines strukturierten und umfassenden Stakeholder-Prozesses zur Erarbeitung einer Strategie, die die Vorgaben der EPBD frühzeitig erfüllt. Im Zuge dieses Prozesses sollte auch die Weiterentwicklung der Ökobilanzierung im Rahmen des QNG diskutiert und vorangetrieben werden. Durch die Formulierung zielkonformer und praxistauglicher Randbedingungen sowie die Realisierung einer niedrigschwelligen Anwendbarkeit kann eine breitere Anerkennung erreicht werden. Zentral ist auch die Förderung und Unterstützung der Qualifikation der Beteiligten, die durch eine Qualifikationsoffensive gestärkt werden sollte, um die erforderlichen Kapazitäten aufzubauen. Indem alle Akteure und Akteurinnen umfassend einbezogen und frühzeitig klare Rahmenbedingungen geschaffen werden, entstehen Akzeptanz und ein gemeinsames Verständnis. So können alle Beteiligten nicht nur von wirtschaftlichen und ökologischen Vorteilen profitieren, sondern auch zur Erreichung von Klima- und Ressourcenschutzzielen beitragen.
Foto: (c) Architectural Visualiszation